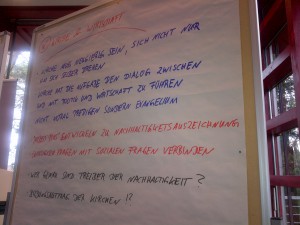Diakonie im Spannungsfeld von theologischem Auftrag und ökonomischer Rentabilität
(Vortrag beim Fakultätstag der Ev. Theol. Fakultät der Universität Basel am 08.Mai 2003)
1. Markenzeichen Diakonie – Kennzeichen der Kirche?
„Diakonie“ jetzt geschütztes Markenzeichen“. Fast ein wenig versteckt, jedenfalls unter „ferner liefen“ fand ich folgende Meldung im Informationsdienst der Diakonischen Konferenz: Rückwirkend vom 6.September 1999 an sei der Name Diakonie ein geschütztes Markenzeichen. Die Eintragung im Patentregister erfolgte am 8.März 2002. Vor ein paar Tagen schließlich auch die Eintragung der Wort- Bild- Marke mit Schriftzug Diakonie und Kronenkreuz als geschütztes Markenzeichen. Damit also ist die Diakonie in Deutschland fit für den Wettbewerb – zumindest, was den Patentschutz angeht. Daß diese Marke allerdings Erfolg hat, daß sie sich durchsetzt und ihr Profil behält, das entscheidet sich in den Herausforderungen des Alltags.
Die EKD- Mitgliederuntersuchung Fremde Heimat Kirche aus dem Jahr 1997 hat gezeigt, daß das Profil der Kirche insgesamt unscharf und widersprüchlich ist – kein Wunder bei einer offenen Kirche in einer unübersichtlichen, differenzierten Gesellschaft. Profil gewinnt die Kirche – nach Meinung der Studien- und Planungsgruppe – wenn sie deutlich macht, worin ihre Kompetenz liegt, nämlich durch ihre Verkündigung, ihre Diakonie und ihre Gemeinschaftsangebote lebensdienlichen religiösen Rückhalt zu geben. Die Befragten erinnerten sich übrigens besonders häufig an die Krankenhausseelsorge und an die häusliche Krankenpflege – mehr als 70% haben damit positive Erfahrungen gemacht. Eine ganzheitliche und zugewandte Pflege gehört nach wie vor zum Profil von Kirche und Diakonie. Um das zu wissen, muß man nicht – wie ich – aus Kaiserswerth kommen, wo Theodor Fliedner 1836 das erste Diakonissen-Mutterhaus gründete und damit dem Diakonischen Amt der Kirche eine entscheidende Prägung gab. Als Florence Nightingale vor mehr als 150 Jahren dorthin kam, um ihre Schwesternausbildung zu absolvieren, schrieb sie in ihrem Bericht: „Man sagt, so eintönige Verrichtungen wie das Kämmen schmutziger Köpfe und das Verbinden abstoßender Wunden könnten nur die übernehmen, die darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen. Die so denken, sollten einmal die Atmosphäre erleben, die ein Krankenhaus beseelt, das man als Schule Gottes ansehen darf, in der Patientinnen wie Pflegerinnen Gewinn davon tragen.“[1]
Geld und Gewinn – für Nightingale wie für Fliedner sind beide Begriffe nicht identisch. „Jetzt weiß ich, was es heißt, zu leben und das Leben zu lieben“, schreibt Nightingale am Ende ihres Kaiserswerth- Aufenthalts und in der alten Hausordnung der Diakonissenanstalt findet sich der Satz, die Pflege der Sterbende bringe auch die Schwestern dem Himmel näher. Wenn Gewinn heute einseitig ökonomisch definiert wird, wenn wesentlich über Geld gesteuert wird, dann zeigt sich an den niedrigen Stundensätzen eben auch ein begrenzter Stellenwert. Bei der damit verbundenen Rationalisierung nimmt nicht nur die Berufsmotivation der Pflegenden Schaden, sondern auch die Würde der Kranken und nicht zuletzt die Marke Diakonie.
Auf diesem Hintergrund muß es nicht wundern, wenn der Begriff Wirtschaftlichkeit in der Kirche einen negativen Klang hat. Bei einer Ausstellung auf dem Frankfurter Kirchentag konnten an unserem Stand fast 1000 Besucher entscheiden, was unsere Kultur des Helfens heute vor allem braucht: dabei stimmten 27% für Eigeninitiative, 25% für Solidarität und 21% für freiwillige, aber nur je 7% für mehr Wirtschaftlichkeit.
2. Non- Profit – Unternehmen zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Im Jahr 2001 erreichte die Sozialleistungsquote in der Bundesrepublik Deutschland, also das Verhältnis von Sozialbudget zum Bruttoinlandsprodukt, eine Größenordnung von 32, 1%. Das ist eine der höchsten ermittelten Quoten in der Geschichte der Bundesrepublik. Es ist weitgehend Konsens, daß der fürsorgliche Wohlfahrtsstaat an seine ökonomischen Grenzen gekommen ist. Ausgangspunkt ist die Krise der Erwerbsgesellschaft und die damit verbundene fiskalische Krise der sozialen Sicherungssysteme. Der Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen ist zwar ungebrochen, ja sie differenziert sich sogar aus. „Aber die Leistungen sind großzügiger, als die Kunden zu zahlen bereit sind.“ schrieb Peer Ederer vor 3 Jahren der sogenannten Deutschland – AG ins Stammbuch. Und er fuhr fort: „Ursachen für die Fehlentwicklung sind das Ausmaß der Angebote, der abzusehende Bevölkerungsrückgang und die mangelnde Anpassung an den sozialen Wandel. Satt einer fortgesetzten Verlustfinanzierung ist eine Optimierung der Preis- Leistungsstrukturen zu empfehlen“.
Diese Analyse macht deutlich, daß es bei dem anstehenden Paradigmenwechsel eben nicht nur um ökonomische Grenzen geht, sondern auch um Fragen des politischen Konzepts. Es wird bezweifelt, daß eine staatlich gesteuerte Wohlfahrtspflege auf die Dauer flexibel genug ist, Angebot und Nachfrage auf dem Gesundheits- und Sozialmarkt aus zu tarieren. Nicht Fürsorge und festgelegte Bedarfe, sondern individuelle Leistungen für unterschiedliche Lebenssituationen sind gefragt – flexible Systeme also, die dem schnellen gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen. In einer Situation, in der die Generationenverträge zerbrechen, weil die Zahl der älteren und chronisch Kranken zunimmt und die Zahl der Kinder in den Familien sinkt, schwindet auch das Vertrauen in kollektive Sicherungssysteme. Auch die zunehmende Individualisierung ist also ein wichtiger Faktor für das Entstehen eines Sozialmarkts, auf dem die Kunden die Dienstleistungen mit steuern. Und die Nachfrage steigt – nicht nur in der Altenhilfe und der Kinderbetreuung. Mehr Eigenleistung, mehr private Finanzierung, mehr Wettbewerb heißt darum die Strategie, um Innovation zu ermöglichen und neue Märkte zu erschließen.
Auch das Zusammenwachsen der Staaten in Europa mit ihren unterschiedlichen Steuer- und Sozialsystemen, Staats – und Kirchenverständnissen und Kulturen führt unweigerlich dazu, daß die Standards der sozialen Versorgung und die Prinzipien ihrer Finanzierung auf den Prüfstand geraten. Frankreich zum Beispiel mit seiner economie sociale kennt den bedingten Vorrang freier Anbieter der Wohlfahrtspflege nicht.[2] Bürgerschaftliches Engagement und Sozialmarkt werden deutlich unterschieden, soziale Aufgaben staatlich zugewiesen. Der zunehmende Wettbewerb mit privaten Trägern, die Aufgabe des Kostendeckungsprinzips und eine veränderte staatliche Zuwendungspraxis, die auf Ausschreibungen basiert, weisen auch in Deutschland in diese Richtung. Erhöhte Qualitätsanforderungen bei sinkenden Entgelten haben das Stichwort Wirtschaftlichkeit zu einem Negativbegriff gemacht. Inzwischen stellt die europäische Einigung die Sonderstellung der freigemeinnützigen Träger in Deutschland in Frage. Die Tendenz ist klar: gleiche Marktchancen für alle Wettbewerber. Wo sich Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege nicht nur als Mitbewerber, sondern auch als „Gemeinwohlagentur“ versteht, müssen sie nachweisbar wertgebunden und uneigennützig arbeiten und soziales Lernen wie Freiwillige Dienste fördern. Die Frage, welche Leistungen der Daseinsvorsorge dienen und eines besonderen staatlichen Schutzes bedürfen, ist noch offen.
Währenddessen setzen wir uns als Träger mit Wettbewerbern aus anderen Wirtschaftsbereichen auseinander: Seniorenresidenzen wie Behindertenheime werden von Caterer und Hotelketten betreiben. Immobilienfirmen denken über die Schnittstelle zwischen Facility-Managament und Pflege nach. Im privaten Sektor vollzieht sich ein Trend zu qualitativ hochwertigen Angeboten, während gleichzeitig der Kostendruck der Kassen zu Billigangeboten – vor allem in den ambulanten Diensten – führt. Jenseits aller politischen Diskussionen ist den Handelnden klar: Die Zukunft der Diakonie entscheidet sich auf dem Markt. Die Rolle des Staates bei der Gestaltung und Finanzierung sozialer Dienste wird abnehmen. Längst schon versuchen die Träger ihre Position am Sozialmarkt zu stärken, in dem sie Teilbereiche in GmbHs ausgründen oder mit anderen koopierieren und fusionieren. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, das Profil diakonischer Arbeit zu schärfen und eine Unternehmenskultur zu entwickeln, die Kunden wie Mitarbeitende binden kann. Bei knappen Kassen und zunehmender Deckelung führt nämlich die Verknüpfung finanzieller Förderung mit inhaltlichen Zielvorgaben dazu, daß die Spielräume für ein eigenes Profil geringer werden – eine Tendenz, die eigentlich dem Marktgedanken widerspricht. Das derzeitige Problem vieler Diskussionen über den Sozialmarkt liegt in seiner extremen Reglementierung. Wo Politik die wesentlichen Rahmenbedingungen und drosselt, ohne umzusteuern, ist strategische Planung schwer möglich.
Angesichts der unternehmerischen Herausforderungen für die Zukunft diakonischer Arbeit lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit :Die Vereins- und Anstaltsdiakonie des 19.Jahrhunderts ist geprägt von Gründerpersönlichkeiten, die mit Mut und Visionen unternehmerische Risiken eingingen .Als Theodor Flieder 1822 als Gemeindepfarrer nach Kaiserswerth kam, gab es weder Kirchensteuern noch Sozialversicherungen. Wohl aber große Arbeitslosigkeit und Armut, ein Gesundheitssystem, das seinen Namen nicht verdiente, soziale Verwahrlosung, schlechte Bildungschancen und eine hohe Kriminalitätsrate. Um seine Familie und die Gemeinde über Wasser zu halten, ging der junge Pfarrer auf Kollektenreise ins europäische Ausland – und brachte neben den 21.000 Talern, die er eingeworben hatte, vor allem neue Ideen mit. So entstanden Anfang der 3O-er Jahre die Rheinisch-Westfälische Gefängnisgesellschaft und ein Asyl für strafentlassene Frauen. Und schließlich im Jahr 1836 die Diakonissenanstalt – eine Antwort auf zwei drängende Fragen seiner Zeit gefunden. Das Mutterhaus gab unverheirateten Töchtern eine gute Ausbildung und eine sinnvolle Aufgabe: sie wurden Schwestern. Und die Schwestern gaben Kranken und Sterbenden, aber auch überforderten Familien professionelle Hilfe – Hilfe zur Selbsthilfe. Quer durch Deutschland und bis in den Nahen Osten reichte diese Kette der Hilfe. Und dabei ging es um mehr als eine Organisationsstruktur. Denn Fliedner sah in der sozialen Not seiner Zeit, nicht nur eine gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch eine religiöse. Menschen waren nötig, denen das Leid der Arbeitslosen, das Elend der Kinder aus verarmten Familien, die Not der Kranken so zu Herzen ging, als wären es ihre Schwestern und Brüder. Die Initiativen der Gründer zielten auf Gemeinschaft, um Verlassene zu integrieren. Und sie setzten auf Bildung, um die Tiefendimension der sozialen Frage bewußt zu machen und Verantwortung zu ermöglichen. Diese Trias von Bildung, Gemeinschaft und Dienst ist nach wie vor aktuell.
Die damaligen Herausforderungen brachten Visionäre auf den Planen. Um aber Visionen in Strategien und schließlich in kleine Münze umzusetzen, muß man Überzeugungsarbeit leisten, Bündnisse schließen und Sponsoren gewinnen. Darin waren die Gründer vorbildlich. Aus sieben verschiedenen Quellen schöpfte Fliedner damals seinen Finanzierungsmix: von Privatspenden über Zuwendungen des Königs bis zu Vereinsmitteln, vom Kostgeld der Patienten über eine umfangreiche Verlags- und Marketintätigkeit bis zu den eigenen Landwirtschaftsbetrieben, der Ökonomie, wie es damals hieß. Und seine Rechnung ging auf, die Idee boomte. Als er 1836 fast 2000 Taler von der Freundin seiner Frau lieh, um das Kaiserswerther Stammhaus zu kaufen, hatte er zwei Schwestern. Als er 1864 starb, gab es 336 Kaiserswerther Schwestern in Mutterhaus, Krankenhaus und ambulanter Pflege, im Lehrerinnenseminar, Kindergarten und Waisenhaus, in Psychiatrie und Fürsorgeeinrichtungen. Beim hundertjährigen Jubiläum 1936 arbeiteten fast 2000 Diakonissen allein in Kaiserswerth – in unterschiedlichen Berufen aber im gleichen Dienst- und Treueverhältnis zum Mutterhaus. Grundloyal, flexibel und gut ausgebildet. Aus der Bewegung war eine Institution geworden – mit internationalen Tochtergründungen, einem durchdachtem Management und einer weitsichtigen Personalplanung. Der Mut von damals kann heute noch tragen – genauso wie die Trias Bildung, Dienst und Gemeinsinn. Die Managementmethoden allerdings passen nicht mehr. Individualisierung, Säkularisierung und nicht zuletzt gewandelte Geschlechterrollen brauchen Berücksichtigung.
3. Nicht nur für Gotteslohn- zur Entwicklung sozialer Dienstleistungen
Eine wichtige Voraussetzungen der Mutterhausorganisation war überholt, als die Einrichtungen noch Zustrom hatten: die Arbeit auf Taschengeldbasis, die lebenslange Versorgung und Verfügbarkeit der Schwestern verlor mit der wachsenden Gleichberechtigung von Frauen an Attraktivität. Als Kaiserswerth 1971 entschied, Diakonissen fortan nach Tarif zu zahlen, war dieser Schritt überfällig, Er fiel einer Zeit des Wachstums, als die Freie Wohlfahrtspflege alle anderen Wirtschaftszweige bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze überholte, nicht zuletzt, weil Frauen hier Arbeit suchten und Unterstützung nachfragten.
Noch immer sind fast 70% der Mitarbeitenden im Non- Profit – Sektor Frauen – gegenüber 41% in der Gesamtwirtschaft. Frauen stellen 95% der Mitarbeiterschaft in Tageseinrichtungen und 78% in Krankenhäusern. Viele davon sind teilzeitbeschäftigt. Die sogenannte Ökonomisierung des Sozialen führt bei gedeckelten Budgets zu einer Rationalisierung von Aufgaben in Pflege, Erziehung und Medizin – Teilzeitarbeitsplätze sind dabei von Vorteil. So zeigt sich z.B. Krankenhäusern, daß die vermuteten Rationalisierungspotentiale insbesondere durch Einsparungen in der Pflege realisiert werden. Dabei müßte die stetige Verkürzung der Liegedauer eigentlich zu einem Mehraufwand für die Pflege führen, weil z.B. die Zahl der Frischoperierten prozentual steigt. Die Situation ist deswegen so problematisch, weil Pflege wie Erziehung und Beratung eigentlich ein Kommunikationsgeschehen ist, Wahrnehmung, Kontakt und Beziehungsarbeit spielt hier eine ebenso große Rolle wie die Professionalität der Handgriffe, die am Ende abrechenbar sind. Gerade da, wo Erfolge sich nur einstellen können, wenn die „Kunden“ das „Produkt“ mit gestalten, können Funktionalisierung und häufiger Wechsel der Dienstleistenden zu einem Verlust an Qualität führen. Keiner spürt das besser als die Pflegenden selbst – die bei zunehmender Arbeitsverdichtung den Verlust ihrer Motivation erleben und oft schon nach kurzer Zeit in andere Arbeitsfelder abwandern.
„Gegenüber den heute einseitigen Vorstellungen von Leistung und Wachstum, von Macht und Gewinn, von Produktion und Dienstleistungen werfen wir unseren Sinn für Freundschaft und Geborgenheit in die Waagschale, unser Gespür für Mitleiden und Trauer, für Begegnung und Verstehen“, heißt es im Leitbild der Luzerner Spitalschwestern. Hier kommt sehr klar die Tiefendimenion des diakonischen Dienstes zum Ausdruck, die wir bei Fliedner und Nightingale fanden. Das Gefühl andere unterstützen zu können und sich auch selbst weiterzuentwickeln, der Aufbau von Beziehungsnetzen gehört zu den wichtigsten Motiven diakonischer Arbeit. Der Gewinn dieser Arbeit liegt in der Erfahrung, daß das Leben intensiver wird, farbiger und tiefer, wenn man es teilt, daß wir unseren Horizont erweitern, wenn wir am Leben anderer teilnehmen. Das Glück der Kranken, oder wenn Sie wollen der Kunden, bringt die eigentliche Wertschätzung. Es geht um life- support, wie Birger Priddat kürzlich gesagt hat – eben nicht um einen militärischen Dienst und auch nicht um eine Sachleistung. Es geht darum, anderen Gutes zu tun, ihnen Entlastung und Assistenz zu geben – etwas sehr Persönliches also. Arbeitsabläufe wie in der Produktion und eine rein ökonomische Steuerung werden als Problem empfunden, weil dabei die emotionale Investition unterschlagen wird, der emotionale Gewinn zu kurz kommt.
Einkommen und Aufstiegsmöglichkeiten können dieses Defizit nicht kompensieren, solange Pflege- und Erziehungsarbeit nicht den gleichen Stellenwert hat wie andere komplexe Dienstleistungen. Jeder Versuch, ausgebildete Familienpflegerinnen oder Hauswirtschaftskräfte auf dem Markt zu plazieren, macht deutlich: aus der privaten Kasse ist kaum jemand bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen, wenn die Krankenkasse diese Leistung nicht übernimmt. Hier konkurriert die Arbeit der Profis mit Schwarzmarktangeboten von Nachbarinnen, Migrantinnen und anderen. Kein Wunder, daß bei uns gelegentlich jemand scherzt, man müsse die Diakonisse neu erfinden – wer arbeitet heute noch bei guter Ausbildung für ein Taschengeld? Ich fürchte, der Rückgang staatlicher Finanzierung bringt an den Tag, daß der gesellschaftliche Stellenwert sozialer Dienstleistungen unklar ist. Es könnte den Pfarrern eines Tages genauso gehen.
Wer heute ein diakonisches Unternehmen leitet, wird den besonderen Charakter dieser Dienstleistungen wahrnehmen. Es geht um Beziehungsdienstleistung, die nur gelingt, wenn alle Beteiligten ihr Teil dazu beitragen. Die Schwester muß, wie Florence Nightingale schreibt, das Herz der Kranken gewinnen. Dazu braucht man neben der fachlichen Bildung Herzensbildung, man braucht Mut und nicht nur die Bereitschaft, sich an Standards zu halten, dazu Höflichkeit und Respekt, Selbstachtung und Menschenliebe. Wer Dienst mit Untertänigkeit verwechselt und deswegen Minderwertigkeitsangst hat, wird unter gebuttert werden und seine Aufgabe nicht erfüllen – ebenso wenig wie der, der Dienst als Herrschaft mißbraucht und deswegen Anweisungen gibt, statt zuzuhören.
Das hat Konsequenzen für die Personalentwicklung und die Mitarbeiterführung. Wie kann es gelingen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu stärken, daß sie sich ihre Motivation erhalten und Eigenverantwortung übernehmen? Standards und Qualitätsmanagement dürfen nicht zur entmündigenden Kontrolle geraten, sie müssen dem Wissensaustausch und der gemeinsamen Organisationsentwicklung dienen. Zielvereinbarungen dürfen nicht zu Zielanweisungen werden – sie sollen helfen, Gaben zu entdecken und Vorschläge einzubringen. Dabei muß neben der Wirtschaftlichkeit die Qualität der Arbeit ihren Stellenwert behalten; nur so kann es nämlich gelingen, daß Leistungsziele die Freude am Gelingen fördern und nicht nur ökonomischen Druck bedeuten.. Dazu brauchen auch die Vorgesetzten Respekt und Menschenliebe, Offenheit und einen Sinn für ehrliche Vereinbarungen.
Ziele und Projekte, Verträge, Vereinbarungen und Kontrakte: diese Begriffe erinnern noch einmal an den grundlegenden Wandel sozialer Arbeit. Nicht nur der fürsorgliche Wohlfahrtsstaat ist am Ende, sondern auch die Fürsorgeinstitutionen, die mit gegebenen Mitteln nach allgemeinen Normen eine anerkannte Aufgabe erfüllen. Lebenskonzepte, Überzeugungen und Ziele sind in einer pluralistischen Gesellschaft so vielfältig wie die Lebensläufe. Darum muß mit Jugendlichen das Entwicklungsziel geklärt, mit Mitarbeitenden eine Zielvereinbarung getroffen werden, und darum müssen auch diakonische Unternehmen ihre Leitbilder ihre strategischen Ziele und Unternehmenskonzepte ausdrücklich beschreiben, damit Kunden wie Mitarbeiter wissen, worauf sie sich einlassen. Fliedner und seine Nachfolger konnten davon ausgehen, daß die eingesegneten Diakonissen aus der gemeinsamen Glaubensüberzeugung heraus ihren Dienst taten – als Richtschnur genügte die Hausordnung. Inzwischen hat sich die Leitungsaufgabe gründlich verändert: die Kirche als Institution hat normierende Kraft und gesellschaftlichen Einfluß verloren. In der gemeinsamen Arbeit müssen unterschiedliche Überzeugungen Raum haben. Die Hierarchien sind flach geworden – auch in den Unternehmen. Dialog statt Anweisung, Beteiligung statt Instruktion: Die Aufgabe des Managements ist es, einen profilierten Rahmen zu setzen, der die Hilfebeziehung schützt, die fachliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden fördert und neue Arbeitsfelder erschließt.
4. Im Dienst ereignet sich Kirche: Spiritualität in der Diakonie
Als Teil der Sozialwirtschaft orientiert sich Diakonie an Bilanzen und Budgets, Kosten und Leistungen, Zielen und Erfolgen geprägt. Der ehemalige Direktor der v.Bodelschwinghschen Anstalten, Johannes Busch, hat einmal gesagt, die Gestalt und die Rahmenbedingungen der unternehmerischen Diakonie trügen keine spezifisch diakonischen Kennzeichen, sie seien säkularer Natur. Das stimmt – gilt aber entsprechend für die behördlich verfasste Kirche. Auch Steuern und Stellenpläne, Stellenschlüssel und Umlagen, Beamtenstatus und Territorialprinzip sind ja nicht per se geistlicher Natur. Die Klärung des Konfessionsstatus durch Ordnungen und Zugehörigkeit zu Institutionen ist die Form publizierten Überzeugungen, die wir kennen. Wer allerdings wie ich in der Diakonie mit Mitarbeiterinnen und Patienten ganz unterschiedlicher Herkunft zu tun hat, der spürt, wie brüchig das alles geworden ist. Da gibt es alles: Migranten, die ihre Konfession kaum nach unseren Kriterien beschreiben können, Kirchenmitglieder, die inzwischen Buddhisten sind, Mulime, die sich ganz protestantisch auf ihr Gewissen berufen, katholische Chefärte, die für die Teilnahme ihrer Mannschaft am Gottesdienst eintreten und viele andere, die keinen Zusammenhang mehr sehen zwischen Kirchensteuer und Diakonie, zwischen Mitgliedschaft und diakonischer Arbeit. Wie kann dieser Zusammenhang deutlich werden?
Zum Beispiel in Palliativversorgung und Sterbebegleitung: Viele Krankenhäuser, Altenheime und Pflegedienste haben Impulse aus der Hospizbewegung aufgenommen oder arbeiten mit ehrenamtlichen Hospizdiensten zusammen. Abschiedsrituale gehören inzwischen zum Qualitätsstandard, Abschiedsräume sind liebevoll ausgestaltet, die Angehörigen werden auf vielfältige Weise einbezogen. Trotz aller Rationalisierung investieren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, um Patienten und Bewohnern ein menschenwürdiges Ende zu ermöglichen. Dabei werden sie unweigerlich mit religiösen Fragestellungen konfrontiert, sie begegnen anderen Religionen und deren Riten und müssen lernen, ihre eigene Position zu beziehen. Nicht nur für die Sterbenden und ihre Angehörigen, auch für die Mitarbeitenden in einem diakonischen Unternehmen ist eine verläßliche seelsorgerliche Begleitung unverzichtbar. Auch gottesdienstliches Angebot für Trauernde – In unserem Krankenhaus nehmen mehr als 70% daran teil – Sterbeseminare und interreligiöse Angebote gehören in diesen Kontext. Entscheidend ist, daß die exklusiven Merkmale der Diakonie wie Gottesdienst und Seelsorge mit den inklusiven wie ganzheitlicher Pflege und Medizin verknüpft werden. Schwieriger als in stationären Einrichtungen scheint das in der ambulanten Pflege zu sein, wo viel von der Zusammenarbeit mit Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern abhängt. Ich erinnere mich an so manche Debatte um Zuständigkeit und wechselseitige Erreichbarkeit, in der die oben angesprochenen Fremdheiten gepflegt wurden. Nicht nur Bestattungsunternehmen und Trauerhäuser, auch so manche Pflegestation hat daraus den Schluß gezogen, eigene Beratungs- und Seminarangebote zu machen. Auf diesem Markt ist der Kirche längst Konkurrenz erwachsen.
Die Bevölkerung allerdings mißt die Glaubwürdigkeit kirchlicher Erklärungen an unserem praktischen Handeln in der Diakonie – zum Beispiel beim Thema Sterbehilfe. Wo die Fürsorglichkeit in der Pflege auf dem Spiel steht, klagen Menschen ihre Freiheit und Selbstbestimmung ein. Gesetze verhindern das nicht. Auch hier zählt nur eine partnerschafliche Begleitung, ein Bündnis für das Leben. Und das ist unserem Glauben angemessen. Denn wir vertrauen doch dem Gott, der unser Leiden geteilt hat und unseren Tod gestorben ist. dem mitleidenden Gott, der den Weg zum Leben öffnet – nicht dem unberührten Herrscher über Tod und Leben. Nicht richtende Distanz, sondern menschliche Nähe, nicht Norm, sondern Freiheit, nicht Moral, sondern der Dienst der Liebe ist also gefragt in unserem Handeln. Und Diakonie tut gut daran, deutlich zu machen, daß das nicht nur unserem Menschenbild, sondern auch unserem Gottesbild entspricht.
Zum Beispiel beim Thema Ethikberatung: Mit der Spannung zwischen dem, was potentiell möglich ist und den tatsächlcihen Rssourcen wachsen die Konflikten in den diakonischen Einrichtungen. Hinzu kommt, daß sich hier eben Menschen aus unterschiedlichen Berufs- und Lebenswelten, Kulturen und Religionen begegnen. Damit wächst der Bedarf an Orientierung und Klärung der eigenen Werthaltung. Gerade in der Diakonie müssen dafür Angebote zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet den Einsatz von Theologinnen und Theologen, die auf dem Hintergrund ihres eigenen Glaubens bereit und in der Lage sind, einen respektvollen Dialog zu führen – interreligiös, interprofessionell, zwischen Vertretern verschiedener Organisationen und Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Interessen. Mit klarem Kopf und Einfühlungsvermögen. Das bedarf der Einübung in Studium und Ausbildung. Seelsorgerliche Erfahrung ist dafür ebenso nötig wie Zeit, Raum, persönliche Autorität und die Bereitschaft, sich zur Verfügung zu stellen. Sich anfunken zu lassen und in der Krise ansprechbar zu sein – zum Dienst bereit wie Ärzte und Pflegende. Nach meiner Erfahrung ist es auch in der Diakonie noch nicht selbstverständlich, daß wir Ethikberatung wie auch Seelsorge als Teil unserer Qualität und als Dienstleistungsangebot betrachten. Dazu gehört Transparenz – auch im Blick auf die Kosten -, die Klärung der Schnittstellen und die Offenheit, sich zu positionieren.
Wo das gelingt, entsteht ein Klima, in dem die Suche nach religiöser Orientierung und persönlicher Spiritualität kein Tabu bleiben muß. Ein diakonisches Unternehmen in einer säkularen Gesellschaft ist darauf angewiesen, daß Mitarbeitende ihr Menschenbild und ihr Gottesbild reflektieren und darüber ins Gespräch kommen – wie über andere Leitgedanken und Haltungen. Die Erfahrungsvielfalt, die dabei zum Ausdruck kommen kann, kann produktiv werden – auch und gerade, was den Dialog mit Hilfesuchenden angeht. Der Institution ist darauf nicht angelegt: die konfessionelle Prägung wie das kirchliche Arbeitsrecht sind auf Zugehörigkeit ausgerichtet – daran ändern vorläufig auch Leitbilder und Zielvereinbarungen nichts. Ausgeschlossen ist es allerdings nicht, daß unter den Bedingungen eines neuen Wettbewerbs- und Arbeitsrechts auf dem europäischen Sozialmarkt eines Tages nur noch die Unterschrift unter das Leitbild Verbindlichkeit schafft. Dann wäre das Mission-Statement der Diakonie tatsächlich auf dem Markt und unsere Überzeugungen würden am Einsatz gemessen.
Man muß nicht in andere Länder gehen, um zu wissen, daß darin auch eine Gefahr steckt: Dienst als Heiligung, Andachten als Frömmigkeitsübung, Seelsorge als Gewissenserforschung diese Tradition wirft ihre Schatten auf unsere Einrichtungen .Kein Wunder, daß Säkularierung auch als Freiheit erlebt wurde. Und dennoch prägen Tagzeitenandachten, Feste und vielfältige persönliche Rituale bis heute unsere Zusammenarbeit. In der Gestaltung der Räume oder beim gemeinsamen Feiern zeigt sich diakonische Kultur – leiblich und sinnlich wahrnehmbar. Wo Mitarbeiter und Klienten, Kollegen und Familien an einem Tisch sitzen, da wird Dienstgemeinschaft erlebbar, da kommen die verborgenen und oft genug mit Füßen getretenen Motive der Arbeit ans Licht: in einer Rede, in einem Geschenk, in einem Gleichnis. Diese Alltagsunterbrechungen empfinden gerade Mitarbeiter aus anderen Arbeitszusammenhängen als besonders kostbar: Hier wird Sinn und Wertschätzung deutlich – ein gemeinsamer Lebens- und Wertzusammenhang quer über alle Ebenen. Ein Bezugspunkt, der Energie gibt und Korrektur ermöglicht. Einführungen und Abschiede, Jahresfeste und Weihnachtsfeiern, Fürbitt- und Klagegottesdienste müssen als Teil der zur Unternehmenskultur von Theologen verantwortet und geschützt werden. Gegen die Rund- um – die Uhr-Gesellschaft in diakonischen Unternehmen, gegen die Zergliederung und Segmentierung aller Abläufe bis hin zur Tischgemeinschaft, gegen Kalkül und Rationalisierung.
Gerade weil die Kirchenbindung der diakonischen Mitarbeiter abnimmt, muß der Resonanzboden des Dienstes erlebbar bleiben. Im Gebet, im gemeinsamen Essen, in Seelsorge und Liturgie. Die Trennung der Subsysteme von Kirche und Diakonie nach dem jeweiligen Kerngeschäft ist dabei kontraproduktiv – ebenso wie ein institutionelles Denken, das nicht mit Erfahrung und Entwicklung, mit Veränderung und Überraschung rechnet. Wo Kranke gepflegt werden, wo Hungrige gespeist oder Kinder aufgenommen werden, wo Flüchtlinge ein Zuhause finden, da ist – oft unerkannt – Christus präsent, da ereignet sich Kirche. In den Werken der Barmherzigkeit wird der Geist Gottes leiblich erfahrbar, das Wort wird Fleisch. Menschen spüren das, wo sie sich auf scheinbar ausweglose Situationen einlassen, Zeit und Ressourcen miteinander teilen und auf diese Weise selbst Gemeinschaft und Stärkung erfahren. In diesem Sinne hat die Vollversammlung in Vancouver festgestellt ¨“ Diakonie als teilendes, heilendes und versöhnendes Amt der Kirche gehört unabdingbar zum Wesen der Kirche. Sie fordert von dem Einzelnen und von der Kirche, daß sie nicht von dem geben, was sie haben, sondern aus dem, was sie sind. Diakonie kann nicht auf den institutionellen Rahmen der Kirche beschränkt werden. Sie muß die bestehenden Strukturen und Grenzen… durchbrechen und durch die Gemeinschaft des Volkes Gottes zum teilenden und heilenden Wirken des Geistes in der Welt werden“.
5. Für eine neue Kultur der Mitmenschlichkeit – zum Diakonat aller
Dabei geht es um mehr als um eine Dienstleistung. Es geht um eine Bewegung, die alle Beteiligten und schließlich auch das Umfeld verändert: Familie und Nachbarschaft, Menschenbild und Gottesbild. Wo Diakonie gelingt, da zieht sie Kreise, regt zum Lernen an, verändert Beziehungen. Deswegen träume ich davon, daß Kirche und Diakonie gemeinsam ein Curriculum für diakonisches Lernen auflegen: von den Praktika im Konfirmandenunterricht über das freiwillige soziale Jahr bis zum Ethikunterricht in den Schulen und Ausbildungsstätten der Diakonie. Von Einführungstagen und Kursen für Mitarbeitende bis zu Retraiten nach fünf oder zehn Jahren. Von den bestehenden Curricula für freiwillige Hospizhelfer, Beraterinnen und andere Ehrenamtliche bis zu Angeboten für Mitarbeiterkinder.
In all dem geht es um die Entwicklung einer diakonischen Haltung, einer neue Kultur der Mitmenschlichkeit. Horst Eberhard Richter nennt diese Bewegung „Das Ende der Egomanie“.[3] Dazu gehört die Akzeptanz der eigenen Geschöpflichkeit, das Wissen um die eigenen Grenzen, die uns auf andere bezogen und angewiesen sein läßt. Es geht um die Unterscheidung von Mensch und Ware, von Liebe und Geschäft und um ein fürsorglichen Umgang mit dem Leben. Es geht darum, fremdes Leid wahrzunehmen und zur Sprache zu bringen und neue Formen sozialer Solidarität zu entwickeln. Ohne diese Kraft zum persönlichen Einsatz, zu Solidarität und Fürsorglichkeit wird die notwendige Veränderung nicht gelingen. Die biblische Tradition, aus der wir schöpfen, kann in diesem Prozess eine große Hilfe sein. Sie lehrt uns, zu begreifen und damit einverstanden zu sein, daß wir nicht Herren unsere Lebens sind und daß wir unser Leben verantworten müssen. Die Texte, die davon sprechen, haben sich tief eingegraben in unsere soziale Kultur – vom barmherzigen Samariter bis zum Gleichnis vom Weltgericht, von der Fußwaschung über die Speisungsgeschichten bis zum 23.Psalm. Generationen haben daran gelernt, in den Geringsten Gottes Ebenbild zu entdecken, auf den Ruf Gottes zu achten und auf Gottes fürsorgliche Liebe zu vertrauen, wenn sie mit anderen teilen. Heute müssen diese Geschichten hinter unserer Geschichte neu erzählt werden – als Kommentar zu den Erfahrungen diakonischer Arbeit – sicher auch als kritischer Kommentar.
Ohne den Zusammenhang von Diakonie und Bildungsarbeit ,den die Gründerväter der Inneren Mission auf dem Hintergrund der Erweckungsbewegung sahen, wird es nicht gelingen, das Profil diakonischer Arbeit wirksam zu schärfen. Ohne eine erneute Bildungsinitiative werden wir auf Dauer keine Menschen für diese Arbeit gewinnen. Diakonie braucht eine fürsorgliche Gesellschaft. Insofern leben die professionellen Mitarbeiter in der Diakonie vom Diakonat aller. In den letzten Jahren waren es vor allem die Freiwilligeninitiativen, die gesellschaftliche Notlagen aktiv aufgegriffen haben. Von der Hospizbewegung bis zu den inzwischen 250 Tafeln, von den Flüchtlingsgruppen bis zu Arbeitsloseninitiativen. Das Selbstbewußtsein und die Unabhängigkeit dieser Bewegungen macht Kooperationen mit diakonischen Trägern schwer – es sei denn, auch die Einrichtungen sind bereit, sich zu verändern. In der Zusammenarbeit zwischen freiwilligen und hauptberuflichen Mitarbeitern geht es nicht nur um Unterstützung und Rechte. Hier werden auch die Grenzen professioneller Arbeit buchstabiert :die Grenzen der Fachlichkeit wie die der Verfügbarkeit. Zugleich wird der unbezahlbare Kern aller diakonischer Arbeit deutlich: die Bereitschaft, sich anderen Menschen zuzuwenden – aus Freude am Menschen oder einfach aus der inneren Überzeugung, daß jedes Leben Sinn hat. „Gib niemals den Glauben auf, daß Gott ein großes Werk an dir vorhat“, hat Luther gesagt. Den Resignierten und Müden, den Kranken und Arbeitslosen diese Perspektive zu eröffnen, das ist Auftrag der Diakonie.
Nicht nur die gedeckelten Budgets begrenzen unsere Möglichkeiten. Auch unsere Zeit und Einsatzbereitschaft, vor allem aber unser Liebesfähigkeit ist begrenzt. Verzicht und Opfer ändern das ebensowenig wie Protest und Aufbegehren. Die letzte Not und Bedürftigkeit des Menschen überwinden wir nicht durch Gesetzlichkeit. Hier kommt es darauf an, daß wir die eigenen Grenzen annehmen und auf die Hilfe anderer vertrauen können. Auf die Zusammenarbeit mit Kollegen, das Netzwerk von Profis und Freiwilligen, das Bündnis von Hilfebedürftigen und Helfern, und auch auf Gottes Werk an uns. Daß nicht alles an unserer Leistung liegt, ist in der Rechtfertigungslehre als wesentliches Kriterium unseres Glaubens beschrieben.In der Dienstleistungsgesellschaft von heute wird klar: Auch die Dienstleister sind auf Dienstleistung angewiesen, sie sind Teil einer größeren Wertschöpftungskette. In diesem Sinne versteht sich Diakonie als eine Kette der Barmherzigkeit. Die Kette bricht, wo Mitarbeitende selbst keine Barmherzigkeit erfahren, wo Konflikte nicht bearbeitet werden, wo die Unterscheidung zwischen Person und Werk nicht gelebt wird. Darum ist gerade Diakonie auf theologische Kritik, auf freie seelsorgerliche Angebote und auf eine wertorientierte Führung angewiesen.